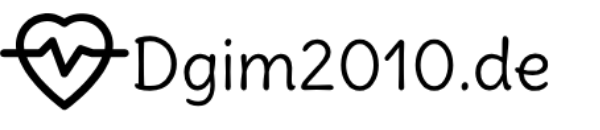Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse: Hashimoto und Morbus Basedow
Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse verstehen
Die Schilddrüse, ein kleines Organ mit großer Wirkung, kann durch Autoimmunerkrankungen aus dem Gleichgewicht geraten. Dieser Artikel beleuchtet die zwei häufigsten dieser Erkrankungen: Hashimoto-Thyreoiditis und Morbus Basedow. Wir erklären, wie diese Erkrankungen entstehen, welche Symptome sie verursachen und wie sie diagnostiziert und behandelt werden. Ein besonderer Fokus liegt auf dem aktuellen Forschungsstand zu COVID-19 und Autoimmunität.
Hashimoto-Thyreoiditis: Die schleichende Entzündung
Die Hashimoto-Thyreoiditis, oft einfach Hashimoto genannt, ist eine chronische Entzündung der Schilddrüse. Sie ist die häufigste Ursache für eine Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose). Bei dieser Autoimmunerkrankung greift das körpereigene Immunsystem die Schilddrüse an und zerstört allmählich das Gewebe. Dadurch wird die Produktion der lebenswichtigen Schilddrüsenhormone eingeschränkt. Frauen sind deutlich häufiger betroffen als Männer, oft im Alter zwischen 30 und 50 Jahren, aber die Erkrankung kann in jedem Alter auftreten. Laut der Heimat Krankenkasse sind etwa 2,5 von 1000 Menschen betroffen, wobei Frauen ein mehr als doppelt so hohes Risiko haben.
Ursachen und Risikofaktoren: Ein komplexes Zusammenspiel
Die genauen Ursachen der Hashimoto-Thyreoiditis sind noch nicht vollständig entschlüsselt. Es wird ein Zusammenspiel aus genetischer Veranlagung und Umweltfaktoren angenommen. Eine Familiengeschichte mit Schilddrüsenerkrankungen oder anderen Autoimmunerkrankungen erhöht das Risiko. Ein übermäßiger Jodkonsum kann, wie die Sana Kliniken in Hürth betonen, bei genetisch vorbelasteten Personen die Krankheit auslösen oder verschlimmern. Chronischer Stress und hormonelle Veränderungen, wie sie beispielsweise nach einer Schwangerschaft auftreten (Postpartum-Thyreoiditis), werden ebenfalls als mögliche Auslöser diskutiert.
Symptome: Vielfältig und oft unspezifisch
Hashimoto verläuft oft schleichend. Anfangs können Symptome fehlen oder sehr mild sein. Manchmal kommt es kurzzeitig zu einer Überfunktion (Hyperthyreose) mit Symptomen wie:
- Gesteigerter Appetit
- Warme, feuchte Haut
- Muskelschwäche
Meist entwickelt sich jedoch eine Unterfunktion (Hypothyreose) mit folgenden typischen Symptomen:
- Müdigkeit und Erschöpfung
- Gewichtszunahme
- Kälteempfindlichkeit
- Trockene Haut und Haarausfall
- Depressive Verstimmungen
- Konzentrationsschwierigkeiten
Diese Symptome sind unspezifisch, was die Diagnose oft verzögert.
Diagnose: Mehr als nur Blutwerte
Die Diagnose basiert auf der Krankengeschichte, körperlicher Untersuchung und Labortests. Wichtig sind Bluttests zur Bestimmung von TSH (Thyreoidea-stimulierendes Hormon) und den Schilddrüsenantikörpern TPO-Antikörpern und Tg-Antikörpern. Ein erhöhter TSH-Wert zeigt eine Hypothyreose an, während Schilddrüsenantikörper die Autoimmunerkrankung bestätigen. Eine Ultraschalluntersuchung der Schilddrüse beurteilt Struktur und Größe. Die MSD Manuals heben hervor, dass ein heterogenes, echoarmes Muster im Ultraschall typisch für Hashimoto ist.
Behandlung: Individuell und oft lebenslang
Hashimoto ist nicht heilbar, aber die Symptome sind gut behandelbar. Levothyroxin (L-Thyroxin), ein synthetisches Schilddrüsenhormon, gleicht den Hormonmangel aus. Die Dosis wird individuell angepasst, um normale TSH-Werte zu erreichen, und muss meist lebenslang eingenommen werden. Das Universitätsspital Zürich (USZ) betont die Notwendigkeit regelmäßiger TSH-Kontrollen, da die Krankheit oft fortschreitet. Bei Hashimoto erfolgt die Hormonsubstitution ohne zusätzliches Jod. Medicheck weist auf mögliche psychische Begleiterscheinungen wie Depressionen und Angstzustände hin und empfiehlt eine ganzheitliche Betreuung.
Morbus Basedow: Die überaktive Schilddrüse
Morbus Basedow, auch bekannt als Graves‘ Disease, ist die häufigste Ursache für eine Schilddrüsenüberfunktion (Hyperthyreose). Im Gegensatz zu Hashimoto stimuliert das Immunsystem bei Morbus Basedow die Schilddrüse, übermäßig Hormone zu produzieren. Spezifische Antikörper, die an den TSH-Rezeptor der Schilddrüsenzellen binden, sind dafür verantwortlich. Frauen sind, wie bei Hashimoto, häufiger betroffen als Männer, was auch Endo-Bochum bestätigt.
Ursachen: Autoantikörper als Auslöser
Morbus Basedow ist eine Autoimmunerkrankung mit noch nicht vollständig geklärten Ursachen. Genetische Faktoren scheinen eine Rolle zu spielen, da die Erkrankung familiär gehäuft auftritt. Auch Umweltfaktoren werden als mögliche Einflussfaktoren diskutiert. Hormonexpert erklärt, dass bei Morbus Basedow TRAK (TSH-Rezeptor-Antikörper) die Schilddrüse übermäßig stimulieren.
Symptome: Ein Spiegelbild der Unterfunktion
Die Symptome von Morbus Basedow sind oft das Gegenteil einer Hypothyreose:
- Nervosität und Reizbarkeit
- Herzrasen
- Schwitzen und Wärmeintoleranz
- Gewichtsverlust trotz gesteigerten Appetits
- Zittern
- Muskelschwäche
- Durchfall
Ein charakteristisches Symptom, das jedoch nicht immer auftritt, ist die endokrine Orbitopathie, eine Augenerkrankung, die zu hervortretenden Augäpfeln, Doppeltsehen und Augenreizungen führen kann. Nau.ch nennt zusätzlich Müdigkeit, Schlafstörungen und Konzentrationsschwierigkeiten. Endo-Bochum erwähnt ungewollten Gewichtsverlust und psychische Veränderungen.
Diagnose: Antikörper und Ultraschall
Die Diagnose stützt sich auf Symptome, Augenveränderungen und Schilddrüsenultraschall. Erhöhte TRAK-Werte im Blut bestätigen die Diagnose, wie Endo-Bochum erklärt. Eine Szintigraphie ist meist nicht nötig.
Behandlung: Mehrere Optionen
Ziel ist die Reduktion der Hormonüberproduktion. Thyreostatika hemmen die Hormonproduktion, Radiojodtherapie zerstört Schilddrüsenzellen, und eine Operation entfernt die Schilddrüse. Die Wahl hängt von Faktoren wie Schweregrad, Alter und Patientenpräferenzen ab. Die Behandlung kann zu einer Hypothyreose führen, die dann behandelt werden muss. Endo-Bochum erwähnt den Versuch, Thyreostatika nach einem Jahr abzusetzen, und den Einsatz definitiver Methoden bei Rückfällen.
COVID-19 und Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse: Ein wachsendes Problem
Aktuelle Forschungsergebnisse zeigen einen deutlichen Zusammenhang zwischen COVID-19-Infektionen und einem erhöhten Risiko für Autoimmunerkrankungen, einschließlich Hashimoto und Morbus Basedow. Der NDR berichtet von einer Studie, die ein um 43 Prozent erhöhtes Risiko für Autoimmunerkrankungen nach einer COVID-19-Infektion feststellt. Besonders bei schweren COVID-19-Verläufen ist das Risiko, eine Autoimmunerkrankung wie Hashimoto zu entwickeln, deutlich erhöht. Es wird vermutet, dass die durch COVID-19 ausgelösten Entzündungsprozesse das Immunsystem fehlleiten und Autoimmunreaktionen gegen die Schilddrüse begünstigen. Nach einer COVID-19-Infektion sollte man daher auf Symptome von Schilddrüsenerkrankungen achten.
Leben mit Hashimoto und Morbus Basedow: Ein ganzheitlicher Ansatz
Autoimmune Schilddrüsenerkrankungen sind zwar chronisch, aber mit richtiger Diagnose und Behandlung ist ein weitgehend normales Leben möglich. Regelmäßige ärztliche Kontrollen, Patientenschulungen und Selbsthilfegruppen sind wichtig. Die Ernährung spielt eine Rolle: Während bei Hashimoto meist keine zusätzliche Jodzufuhr empfohlen wird, ist bei Hypothyreose oft ein ausreichendes Jodangebot wichtig. Stressmanagement und psychologische Unterstützung können hilfreich sein. Diese Erkrankungen können mit anderen Autoimmunerkrankungen einhergehen, was eine ganzheitliche Betrachtung erfordert. Deximed betont die Bedeutung einer umfassenden Betreuung, die sowohl körperliche als auch psychische Aspekte berücksichtigt. Die Früherkennung und ein proaktives Management sind entscheidend, um die Lebensqualität zu erhalten und Komplikationen vorzubeugen.